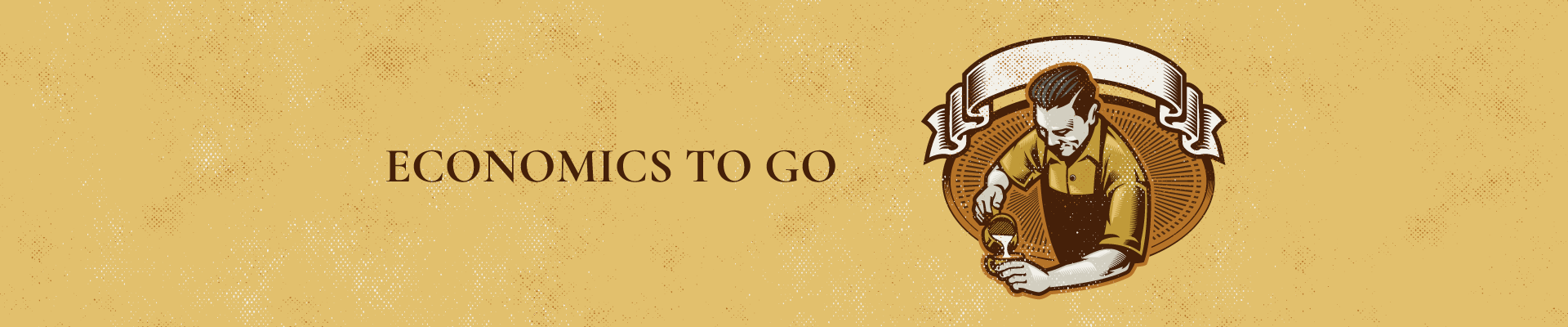
Hier werden komplexe wirtschaftliche und politische Themen auf das Wesentliche herunter gebrochen.
Podcast #29: US-Präsidentschaftswahl – Trump bringt sich in Stellung
13.02.2024
Ein Gespräch zwischen Dr. Jackson Janes (German Marshall Fund, Washington D.C.), Klaus-Dieter Frankenberger (FAZ) und Dr. Jörn Quitzau.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Gesellschaftliche Spannungen – Die Rolle der Kollektivgüter
30.01.2024
Politikverdrossenheit ist zu einem guten Teil darauf zurückzuführen, dass der Staat seinen Bürgern nur „One size fits all“-Lösungen anbieten kann. Die Bürger müssen mit dem leben, was die gewählte Regierung beschließt. Sie müssen Kompromisse eingehen, die sie von privaten Konsumentscheidungen kaum noch kennen – denn hier erhalten sie maßgeschneiderte Lösungen. Es liegt daher nahe, dass die Politik bei möglichst vielen Themen keine kollektiven Lösungen anstreben, sondern sich auf die klassischen öffentlichen Güter konzentrieren sollte. Zudem wären Volksentscheide geeignet, die Präferenzen der Bürger besser zu berücksichtigen als es gegenwärtig der Fall ist
Eine ausführlichere Analyse von Dr. Jörn Quitzau finden Sie hier: Gesellschaftliche Spannungen Die Rolle der Kollektivgüter – Wirtschaftliche Freiheit
Podcast #28: Eindrücke aus Davos
25.01.2024
Prof. Dr. Henning Vöpel (CEP) war dabei und schildert hier im Gespräch mit Dr. Jörn Quitzau (Berenberg) seine Eindrücke.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Podcast #27: Mit Wachstumsverzicht den Klimawandel stoppen?
22.01.2024
Ein Kurzgespräch zwischen Prof. Dr. Jan Schnellenbach (Technische Universität Cottbus) und Dr. Jörn Quitzau (Berenberg).
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Podcast #26: Fiskalische Nachhaltigkeit – Welche Rolle spielt die Migrationspolitik?
15.01.2024
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Podcast #25: Euro und US-Dollar – Wohin geht die Reise?
11.01.2024
Brian Knobloch und Jörn Quitzau (beide Berenberg) im Kurzgespräch.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Podcast #24: Wissenswertes zur Schuldenbremse
12.2023
Dr. Jörn Quitzau skizziert einige wichtige Hintergründe zur aktuellen Haushaltskrise.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Podcast #23: Argentinien – Führt der neue Regierungschef das Land aus der Krise?
11.2023
Nils Sonnenberg (Institut für Weltwirtschaft) gibt im Gespräch mit Dr. Jörn Quitzau (Berenberg) seine Einschätzung ab.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Podcast #22 – Immobilienmarkt in der Krise – Was kann der Staat tun?
11.2023
Aygül Özkan (Geschäftsführerin des Zentralen Immobilien Ausschusses, ZIA) gibt im Gespräch mit Dr. Jörn Quitzau (Berenberg) ihre Einschätzung ab.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Nach dem Verfassungsgerichtsurteil: Wie geht es weiter mit der Schuldenbremse?
22.11.2023
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes stellt die Bundesregierung vor schwerwiegende Probleme – finanziell und politisch. Die haushaltspolitische Solidität wurde mit dem Urteil gestärkt, zumindest kurzfristig. Ob das aber auch dauerhaft gilt oder der Richterspruch vielmehr zu neuen Umgehungstricks oder einer unangemessenen Aufweichung der Schuldenbremse führt, bleibt abzuwarten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, der Regierung finanziell wieder mehr Luft zu verschaffen. Einige davon könnten sogar für die CDU/CSU interessant sein, die sich damit für eine künftige Regierungsbeteiligung finanzielle Spielräume verschaffen könnte, ohne offiziell von der Schuldenbremse abrücken zu müssen.
Eine interessante Einschätzung von Prof. Dr. Jan Schnellenbach zu diesem Thema finden Sie hier: Das Schuldenbremsen-Urteil – Ein Pyrrhus-Sieg?
Strategische Industriepolitik: Ein neuer (erfolgloser) Versuch
21.11.2023
Industriepolitik steht für die gezielte staatliche Beeinflussung der sektoralen Produktionsstruktur einer Volkswirtschaft. Lange Zeit war Industriepolitik aus der Mode, doch nun ist sie mit Macht zurück. Viel spricht dafür, dass Industriepolitik auch diesmal nicht von Erfolg gekrönt sein wird.
- Staatliche Zuwendungen (Subventionen) schwächen bei den begünstigten Unternehmen den Druck, im Wettbewerb mit anderen Unternehmen besser zu werden.
- Zukunftstechnologien sind schwer zu identifizieren. Warum sollten Politiker hier Vorteile gegenüber privatwirtschaftlichen Akteuren haben, die ihr Geld damit verdienen, Zukunftsmärkte und -technologien aufzuspüren?
- Die Erfahrungen mit der japanischen Industriepolitik und den Versuchen in Europa, mit strategischer Industriepolitik zu kontern, verheißen nicht viel Gutes. Viele industriepolitische Projekte sind gescheitert.
- Die Fokussierung auf Großunternehmen führt im Inland zu einer Wettbewerbsverzerrung zwischen großen und kleineren Unternehmen.
Eine ausführlichere Analyse von Prof. Dr. Henning Klodt finden Sie hier: Strategische Industriepolitik – Mit Schwung ins technologische Abseits
Podcast #21 – Rentenreform: Wie sind die Vorschläge des Sachverständigenrates zu bewerten?
13.11.2023
Dr. Tobias Kohlstruck (Stiftung Marktwirtschaft) gibt im Gespräch mit Dr. Jörn Quitzau (Berenberg) seine Einschätzung ab.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Podcast #20 – Zinsanstieg: Ist ein Ende in Sicht?
10.11.2023
Was sind die Gründe, wie geht es weiter und was bedeutet es für den deutschen Hausbauer?
Ein Gespräch mit Dr. Christoph Kind (Marcard, Stein & Co.) und Dr. Jörn Quitzau (Berenberg).
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Gesellschaftliche Spannungen: Was hält Gesellschaften zusammen?
31.10.2023
Was hält Gesellschaften zusammen? Es sind vor allem drei Elemente:
1. Gemeinsamkeiten
2. Gesetze (geschriebene und ungeschriebene)
3. Vertrauen.
Gemeinsamkeiten machen das Leben einfach. Wenn Normen, Werte, Erfahrungs- und Erlebnishintergründe, Sprache, Religion und Weltanschauungen halbwegs übereinstimmen, ist das eine gute Voraussetzung für ein harmonisches Miteinander. Werden gemeinsame Lebensrisiken wie Pflegebedürftigkeit, Krankheit oder Berufsunfähigkeit über eine staatliche Sozialversicherung abgesichert, entsteht eine Solidargemeinschaft.
(Ungeschriebene) Gesetze regeln das Verhalten der Bürger. Sie sind die Leitplanken für das Zusammenleben. Zu den ungeschriebenen Gesetzen gehören informelle Regeln und Normen. Informelle Regeln sind Gewohnheiten, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben. Normen dienen als Orientierung, was in bestimmten sozialen Situationen eine angemessene Handlung ist. Verhaltensnormen vereinfachen den Alltag, weil das jeweils angemessene Verhalten nicht in jeder Situation ständig neu entschieden und abgewogen werden muss. Normen abstrahieren von der individuellen Besonderheit und repräsentieren daher immer das Allgemeine oder Typische. Informelle Regeln und Normen sind oft über viele Jahre, Jahrzehnte und manche sogar über Generationen gewachsen. Sie gelten nicht universell oder global, vielmehr weichen sie in unterschiedlichen Regionen, Ländern und Kulturkreisen voneinander ab. Zudem unterliegen sie einem gewissen Wandel.
Vertrauen wird überall dort benötigt, wo es kein vollständiges Wissen bzw. keine vollkommene Gewissheit gibt. In der Wirtschaft senkt ein vertrauensvolles Miteinander die sogenannten Transaktionskosten. Im täglichen Leben hilft es, wenn Menschen, die sich nicht oder nicht gut kennen, darauf vertrauen können, dass sich alle an die gängigen Gepflogenheiten halten.
Gemeinsamkeiten, Gesetze und Vertrauen bilden den sozialen Kitt, von dem Gesellschaften zusammengehalten werden. Ein funktionierendes Gemeinwesen ist alles andere als selbstverständlich. Was wir seit einigen Jahren erleben, ist der Verlust der gewachsenen und etablierten Strukturen. Ein schnelles Ende der gesellschaftlichen Spannungen ist nicht in Sicht, weil sich neue Strukturen und gemeinsame Wertvorstellungen wachsen müssen – verordnen lassen sie sich nicht.
Eine ausführlichere Analyse aus dem Jahr 2018 finden Sie hier: Gesellschaftliche Spannungen_kurz
Podcast: 10 Gebote… für eine bessere Wirtschaftspolitik
19.10.2023
Mit Wortbeiträgen von Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen, Dr. Gertrud Traud, Dr. Matthias Kullas, Prof. Dr. Stefan Kooths, Prof. Dr. Jan Schnellenbach, Prof. Dr. Joachim Weimann, Prof. Dr. Ronnie Schöb, Dr. Melanie Häner, Prof. Dr. David Stadelmann und Dr. Jörn Quitzau.
Wenn Sie weitergehendes Interesse haben, lesen Sie das Buch: „Die Wirtschafts-Welt steht Kopf“, herausgegeben von Prof. Dr. Norbert Berthold und Dr. Jörn Quitzau, mit Beiträgen von 27 renommierten Experten.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Podcast #18 – Rasant steigende Zinsausgaben beim Bund
19.10.2023
Ein Gespräch zwischen Dr. Tobias Hentze (IW Köln) und Dr. Jörn Quitzau (Berenberg).
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Podcast #17 – Der Niedergang der Volksparteien
12.10.2023
Ein Kurzgespräch zwischen André Broders und Jörn Quitzau.
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
Demografischer Umbruch: Kann Zuwanderung das Problem lösen?
02.10.2023
Der Arbeitskräftemangel könnte für Deutschland zu einem ernsthaften strukturellen Problem werden. Denn was sich über Jahrzehnte angekündigt hat, wird nun zur Realität. Die geburtenstarken Jahrgänge (die sogenannten Babyboomer, Jahrgänge 1955-1969) verlassen nach und nach den Arbeitsmarkt und gehen in den Ruhestand. Im Jahr 2036 werden die letzten Babyboomer im Ruhestand sein. Damit geht dem Arbeitsmarkt eine sehr große Zahl qualifizierter Arbeitskräfte verloren. Und für den Staat bedeutet es, dass sehr viele bisherige Steuer- und Beitragszahler zu Leistungsempfängern (Rentenbeziehern) werden. Kann Zuwanderung das Problem lösen?
Die reinen Zuwanderungszahlen sprechen dafür, dass Deutschland auf einem guten Weg ist, die Bevölkerung zu verjüngen und das eigene demografische Problem zu lösen. Allerdings ist es Deutschland noch nicht gelungen, die Zuwanderung so zu steuern, dass sie vor allem den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes und der öffentlichen Finanzen entspricht. Bisher ist die Zuwanderung stark getrieben von (geo)politischen Ereignissen. Aus humanitärer Sicht hat Deutschland in den vergangenen Jahren in dieser Hinsicht eine große Leistung vollbracht. Wenn es aber darum geht, die Zuwanderung stärker an den eigenen Bedürfnissen zu orientieren, lohnt sich der Blick über den Atlantik. Die USA und Kanada haben eine lange Einwanderertradition und können wertvolle Einsichten für Deutschland liefern. Die Bundesregierung hat insbesondere Kanada als Vorbild entdeckt und erste Schritte unternommen, um sich von Kanada für ein modernes Einwanderungsrecht inspirieren zu lassen. Gut so, denn die Zeit drängt.
Lesen Sie hier den ganzen Beitrag „Germany Faces a Challenging Demographic Situation“ auf der Website des American-German Institute.
Zum Niedergang der Volksparteien
01.10.2023
Die Angst geht um. CDU/CSU und SPD kämen bei einer Bundestagswahl gemäß aktuellen Umfragen (INSA vom 23. September) zusammen nur noch auf 44 % der Wählerstimmen. Das wäre der vorläufige Tiefpunkt eines jahrzehntelangen Erosionstrends der ehemals großen Volksparteien. In den 1970er Jahren erreichten sie bei Bundestagswahlen in der Spitze gemeinsam noch über 90 % der Wählerstimmen. Woran liegt das?
Der Bedeutungsverlust der Volksparteien ist auch ein Spiegelbild einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft. In einer zunehmend „diversen“ Gesellschaft ist es kein Wunder, dass auch die Parteienlandschaft vielfältiger wird. Doch es bleibt ein Problem: Trotz der neuen Vielfalt kann die Politik weiterhin nur „One-size-fits-all“-Lösungen anbieten. Während die Bürger sonst die Wahl aus einem gewaltigen Waren- und Dienstleistungsangebot haben und maßgeschneiderte Lösungen für ihre Wünsche bekommen können, kann die Politik nur Lösungen „von der Stange“ anbieten, die jeweils an den Wünschen der meisten Bürger vorbeigehen. Frust ist also vorprogrammiert.
Hinzu kommt: Es sind Zweifel angebracht, ob die Themen, über die heute politisch und gesellschaftlich so vehement gestritten wird, den Bürgern mehrheitlich unter den Nägeln brennen. Vielmehr drängt sich der Verdacht auf, dass Minderheiten jeglicher Couleur überdurchschnittlich starken Einfluss auf die Parteien und damit die Politik insgesamt bekommen haben. Der politische Fokus rückt damit weg von den Interessen der Mehrheitsgesellschaft hin zu den Interessen von Minderheiten. Dies mag fortschrittlich sein und zuweilen ehrenwerten Motiven entspringen. Doch wer Politik vorwiegend für Minderheiten macht, darf nicht überrascht sein, wenn er auf lange Sicht nicht mehr von der Mehrheit gewählt wird. Der Status der Volkspartei wird einbüßt.
Lesen Sie hier den ganzen Beitrag „Strauchelnde Volksparteien, verspannte Gesellschaften – Kaum Besserung in Sicht“ bei Wirtschaftlichefreiheit.de.
Podcast #16 – Heizungsgesetz: Was wäre die Alternative?
25.09.2023
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Spotify zu laden.
